Der Weg in eine Psychotherapie ist für viele Menschen wie das Greifen nach dem letzten Strohhalm. Die Hoffnungen und Erwartungen an die Therapie und den Therapeuten sind entsprechend groß. Vor allem, dass der Psychotherapeut wirklich jemand ist, der einem helfen kann. Doch was ist mit den Erwartungen der Therapeuten? Auch sie erwarten so einiges von ihren Patienten. Und genau darum soll es hier gehen.
Inhaltsverzeichnis
Ein Beispiel aus der Praxis
Starten wir mit einem realen Dialog zwischen Therapeut(T) und Patient(P). Der Patient leidet unter einer Angststörung, sein Therapeut arbeitet verhaltenstherapeutisch. Es sind einige Sitzungen vergangen und der Therapeut erwartet von seinem Patienten, dass dieser sich seinen Ängsten in konfrontativen Übungen stellt. In der heutigen Sitzung besprechen sie, warum der Patient sich nicht getraut hat so eine Übung zu machen:
T: „Haben Sie die Aufgaben gemacht, die wir gemeinsam in der letzten Sitzung vereinbart haben?“
P:“ Nein, um ehrlich zu sein nicht. Ich meine, ich habe es versucht… Ich bin schon losmarschiert, aber am Ende konnte ich einfach nicht. Das hat mich überfordert.“
T: „Aber Sie wissen doch, dass das entscheidend ist für Ihren Therapieerfolg. Solange Sie nicht ins Tun kommen und sich konfrontieren, wird sich nichts verändern. Ihre Angst wird bleiben. Sollen wir gemeinsam nochmal die Angstkurve besprechen?“
P: „Das weiß ich auch, wirklich. Aber es ist so schwer. Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit.“
T: „Worin genau liegen Ihre Schwierigkeiten?“
P: „… Das fällt mir jetzt wirklich schwer zu sagen. Das ist mir unangenehm.“
T: „In so einem Fall werde ich Ihnen leider nicht helfen können, wenn Sie es mir nicht erzählen mögen.“
P: „Ich kann nicht. Ich schäme mich zu sehr.“
T: „Wissen Sie, wir treten seit Wochen auf derselben Stelle und es gibt kein Vorankommen. Da könnte der Eindruck entstehen, Sie wollen ihre Ängste gar nicht loswerden.“
 Die Erwartungen der Therapeuten
Die Erwartungen der Therapeuten
Solche Worte hört kein Patient gerne oder? Fairerweise muss ich sagen, solche Worte können absichtlich gewählt sein, um den Patienten aus der Reserve zu locken. Doch manchmal deuten sie nur auf unausgesprochene Erwartungen der Therapeuten hin.
Patienten sollen sich auf die Behandlung einlassen. Sie sollen sich öffnen und ihrem Therapeuten vertrauen.
Patienten sollen dem Behandlungsplan folgen und sich für Veränderungen in ihrem Leben bereit erklären. Sie sollen sich kritisch hinterfragen, sich reflektieren und analysieren.
Patienten sollen sich konfrontieren mit dem, was ihnen unglaubliche Angst macht.
Sie sollen sich einer Diagnostik unterstellen, aber nicht zu viele Fragen bezüglich ihrer Diagnosen stellen.
All das sind Erwartungen an Patienten, damit ihre Therapie erfolgversprechend verläuft. Natürlich dienen diese Erwartungen nur zum Besten der Patienten. Doch die Wahrheit ist – über diese Erwartungen wird kaum gesprochen. Vor allem in Kliniken wird vieles sogar vorausgesetzt, aber nur selten offen kommuniziert. Ich weiß, das klingt nun schrecklich und kritisch. Und ich gehe auch kritisch mit diesem Thema um, denn ich finde es gibt noch viel Luft nach oben, um es Menschen leichter zu machen zufrieden zu sein mit ihrer Therapie.
Ist das richtig?
Es ist nicht meine Absicht Therapeuten zu kritisieren oder anzugreifen. Sie geben nach bestem Wissen und Gewissen ihr Bestes, um ihren Patienten zu helfen. Doch auch Therapeuten sind „nur Menschen“ und verlieren sich manchmal in ihrer täglichen Routine. Auch sie vergessen es manchmal, sich in die Lage ihrer Patienten hinein zu versetzen. Wie ist es ein Patient zu sein? Liegt der Fokus der Therapie wirklich auf dem Wohl des Patienten oder auf dem Gelingen einer Therapie? Oder geht es doch nur um eine Methode, die laut Forschung als bewehrt gilt?
Therapeuten sind auch nur Menschen. Und Menschen neigen dazu, Erwartungen zu entwickeln, wenn sie mit anderen Menschen arbeiten. Das passiert automatisch und unbewusst. Wie du die Erwartungen deines Therapeuten entlarven kannst, erfährst du hier.
Selbsterfahrung und Supervision sollen Therapeuten helfen, die Situation eines Patienten besser zu verstehen und nachzufühlen. Doch nicht jeder gestandene Therapeut geht zur Selbsterfahrung. Nicht jeder Therapeut nimmt an einer Supervision teil. Vor allem an psychosomatischen Kliniken ist mir aufgefallen, dass Therapeuten Fließbandarbeit leisten. Natürlich liegt das am hohen Arbeitspensum und am Zeitmangel. Aber leider wird genau dadurch viel zu wenig kommuniziert.
 Patienten müssen in der Therapie viel „sollen“
Patienten müssen in der Therapie viel „sollen“
Als Patient gibt man den Erwartungen meistens nach. Stillschweigend ist man einverstanden. Denn in einem System, in dem Betroffene durchschnittlich 19 Wochen auf einen Therapieplatz wartet, werden am Ende nicht mehr viele Fragen gestellt. Jeder ist froh, wenn das Warten endlich ein Ende hat.
Nicht umsonst heißt Psychotherapie auch „Hilfe zur Selbsthilfe“. Wer Hilfe sucht, muss auch bereit sein, Hilfe anzunehmen und selbst aktiv etwas für die Verbesserung der eigenen Lage zu tun. Wer im Therapie-Prozess stockt, zweifelt, sich nicht an Abmachungen hält, nicht mit der Geschwindigkeit des Therapeuten mitzieht, sich nicht öffnet oder sich nicht an gut gemeinte Ratschläge des Therapeuten hält, gilt oft als was? Schau mal hier:
Noch nicht bereit.
Nicht motiviert genug.
Es fehlte das Verständnis.
Es gebe noch zu viele Ängste, zu viele Blockaden.
Oder wolle man gar nicht gesund werden?
Auch der Therapeut aus unserem Beispiel unterstellt seinem Patienten, dass er gar nicht gesund werden will. Dass er seine Angststörung in Wahrheit gar nicht loswerden möchte. Weil sein Leidensdruck nicht groß genug sei. Also müsse er mit seinen Ängsten weiterleben. So eine krasse Schlussfolgerung kann im Sinne einer paradoxen Intervention funktionieren. Aber es kann auch das Vertrauen zwischen Patient und Therapeut mindern und sogar zu dem Punkt kommen, dass der Patient resigniert. Wie siehst du das?
Wenn du jetzt denkst, dass mein Beispiel echt hart ist und ich mir das bestimmt nur ausgedacht habe … Es ist real und keine große Ausnahme. Viele Patienten werden genau so behandelt.
Über Erwartungen wird zu wenig gesprochen
Ich bin der Meinung, dass in der Therapie viel vorausgesetzt und erwartet wird. Aber leider wird zu wenig miteinander kommuniziert. Und zwar offen und menschlich und vor allem auf Augenhöhe.
Manche Patienten gehen durch harte, aufwühlende, kräftezehrende Zeiten. Und das jahrelang vor der Therapie und dann während der Therapie selbst. Nicht jeder Patient kann das durchhalten. Manche ziehen sich für eine Weile aus der Therapie zurück oder brechen ganz ab.
 Mögliche Gründe
Mögliche Gründe
Einer der Gründe ist die Therapeut-Patient-Beziehung. Wenn beide nicht auf Augenhöhe kommunizieren, entsteht automatisch ein Machtgefälle. Der Therapeut nimmt dabei eine machtvollere Position ein. Er ist der „Profi“, der analysiert, sieht, versteht und mehr weiß. Der Patient nimmt die Rolle des „Unterlegenen“ ein. Er sieht weniger, weiß weniger und versteht vielleicht weniger. In so einer Konstellation schleichen sich automatisch Erwartungen ein.
Ein anderer Grund liegt am Tempo der Therapie. Wenn das Tempo in der Therapie zu hoch angesetzt ist, bleiben Ressourcen, Bedürfnisse und Kapazitäten der Patienten auf der Strecke.
Ein weiterer Grund liegt in der ungenügenden Aufklärung über Therapie-Prozesse. Darüber, was auf Patienten zukommt und womit sie rechnen müssen. Über Chancen, Risiken, Nebenwirkungen und über Grenzen einer Therapie. Erwartungen der Therapeuten werden zu allgemein gültigen Voraussetzungen der Therapie und werden höchstens kurz angesprochen.
Ich bin der Meinung, einen guten Therapeuten macht aus, dass er sich Zeit nimmt, um seine Patienten aufzuklären. Und zwar so, dass wirklich klar wird, worauf es in der Therapie ankommt. Was wirklich wichtig ist, wie eine gute Therapie funktionieren kann, welche Rolle Diagnosen spielen, was passiert, wenn die Therapie nicht anschlägt, usw. Der beste Zeitpunkt dafür sind die probatorischen Sitzungen. Doch eine gute Aufklärung, offenes Miteinander und Menschlichkeit, sollten grundsätzlich Teil der Therapie sein. Zu jedem Zeitpunkt.
Therapie erfordert Bereitschaft und bedeutet Arbeit
Als Patient fühlt man sich oft hoffnungslos und kraftlos. Wer sonst begibt sich freiwillig in eine Psychotherapie, wenn nicht ein Mensch mit enormen Leidensdruck, Verzweiflung und tiefem Kummer?
Es liegt an den Therapeuten, ihren Patienten Mut zuzusprechen und ihre Bereitschaft zu stärken, den Veränderungsprozess in ihrem Leben aktiv anzutreten. Es ist die Aufgabe der Therapeuten ihren Patienten Mut zu machen den Therapieprozess aktiv mitzugestalten. Und es ist absolut wichtig, das Tempo an die Möglichkeiten der Patienten anzupassen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie als Mensch im Mittelpunkt stehen.
Selbst wenn all das, was Therapeuten mit ihren Patienten machen, absolut richtig wäre, so dürfen sie nicht davon ausgehen, dass es den Patienten genauso bewusst ist.
Es liegt an den Therapeuten, ihre Patienten auf dem Weg zu begleiten. Therapeutische Vorstellungen von „richtig“ oder „falsch“, „genügend“ oder „ungenügend“ spielen dabei keine Rolle. Es geht um die Möglichkeiten jedes einzelnen Patienten.
 Menschen werden damit groß, zu MÜSSEN
Menschen werden damit groß, zu MÜSSEN
Wie oft führen unsere eigenen Überzeugungen zu einem Leben voller MÜSSEN und SOLLEN? Wie oft ist unser eingefahrenes, rigides Bewertungs-, Erwartungs- und Verhaltenssystem dafür verantwortlich, dass wir unsere Zufriedenheit, Gelassenheit und Flexibilität verlieren?
Es liegt in den Aufgaben der Therapie den Menschen die Augen zu öffnen, dass ein MUSS und SOLL einem Gefängnis gleicht.
Warum also müssen Patienten in der Therapie SOLLEN? Dieses SOLLEN kann nicht mit Forschungsergebnissen, bewehrten Manualen oder der Erfahrung der Therapeuten gerechtfertigt werden.
Die besten Chancen der Therapie liegen darin, wenn Therapeuten ihren Patienten von einem MÜSSEN und SOLLEN zu einem WOLLEN und DÜRFEN bewegen.
Das ist kein Appell an Kuschel-Therapie mit Samthandschuhen. Doch es ist ein Denkanstoß an ein tieferes Verständnis für die Situation eines Patienten. Patient-Sein darf in der Therapie nicht zweitrangig werden.
Es ist ein Denkanstoß an mehr Wertschätzung und Menschlichkeit für die Menschen, die den Weg in die Therapie suchen.
Wie du diesen Artikel nutzen kannst
Wenn du eine Psychotherapie machen willst oder dich bereits in Behandlung befindest und dich nicht immer wohl fühlst oder wenn du dich in diesem Text wieder erkennst, dann überlege bitte Folgendes:
DU als Patient hast großes Mitspracherecht in deiner Therapie. Es ist eine Dienstleistung, die für DICH erbracht wird. Wie du das für dich nutzen kannst, erfährst du in diesem Artikel.
Was ist nötig, damit du dich in deiner Therapie wohl fühlst? Was würde dir gut tun, damit du dich öffnen und dich auf den Therapieprozess einlassen kannst?
Überlege, welche Fragen du klären müsstest. Welche Erwartungen hättest du an deinen Therapeuten? Und was musst du von deinem Therapeuten erleben, um ihm zu vertrauen?
Scheue dich nicht deine Fragen, Anliegen und Wünsche aktiv mit deinem (potenziellen) Therapeuten zu klären. Warte nicht darauf, bis dieser selbst auf die brillante Idee kommt und deine Fragen, Anliegen und Wünsche errät.
Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit!
Tatjana
Du siehst hier Bilder von @Alex Azabache von Pexels.









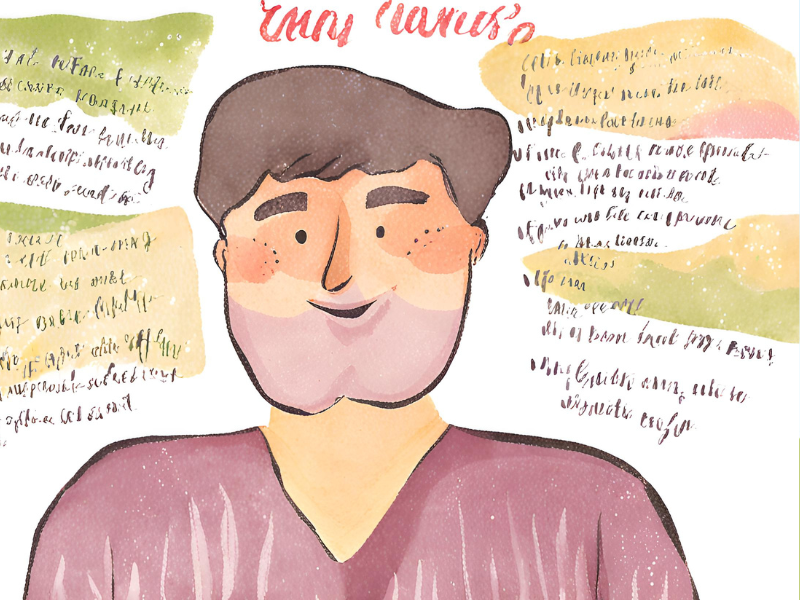






12 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Hat mir geholfen mich als selbstvestimmter Anteil in einer Psychotherapie zu erleben. Ich fühle mich durch einen Angriff meiner Therapeutin in der Traumaklinik in der sie mir erklärte, dass sie meine Wut nicht spüre, obwohl ich zu diesem Moment wirklich wütend war, verletzt. Ich finde es ist ihr Problem wenn sie mich nicht spürt.
Allerdings kam durch diese Unterstellung eine krass heftige Wut in mir hoch , die ich dann gegen sie richtete und auch nicht mehr sachlich besprechen konnte. Ich war dann wirklich in Kampfmodus. Und als sie mir dann auch noch unterstellte, dass ich mich in bisherigen Gruppensitzungen „wohl sehr zusammen gerissen habe“ weil nie Wut spürbar war und dies doch mein Thema mit dem ich in die Klinik gekommen sei, war es bei mir vorbei. Sie fragte mich ernsthaft wie ich es mache so ruhig zu bleiben.
Ich sagte, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter(59J.) Methoden wie Yoga oder Meditation gelernt habe.
Ich war dann aber wirklich krass wütend auf sie. Und insgesamt erinnerte mich alles an einen krassen Streit mit meiner Mutter als anscheinend mein Vertrauen kaputt ging,
Liebe Annette,
vielen Dank, dass Sie diese persönliche Erfahrung mit mir geteilt haben.
Manchmal sind solche Äußerungen ein Teil einer therapeutischen Intervention mit einem bestimmten Ziel, das dahinter steckt. Jedoch ist es wichtig, damit im Gespräch zu bleiben und dem Patienten auch zu vermitteln, WARUM man so eine Äußerung tätigt. Es sollte in dem Moment nichts „persönliches“ sein, sondern z.B. auf einen Bewältigungsmechanismus aufmerksam machen. Und eben dieser Bewältigungsmechanismus sollte dann weiterhin Gesprächsthema sein. Wenn es allerdings so rüberkommt, als wäre es ein persönlicher Kommentar, geht der Schuss selbstverständlich nach hinten los. Wäre ich in Ihrer Situation gewesen, wäre ich vermutlich auch ärgerlich geworden, hätte mich angegriffen, bewertet und vielleicht sogar unverstanden gefühlt. Vielleicht hätte ich mich sogar gefragt, wie es sein kann, dass sie nicht versteht, warum ich nicht wütend sein kann/will.
Das ist ein grundsätzliches Problem in der Therapie:
Manche Fragen und Kommentare sind Teil einer bestimmten therapeutischen Intervention. Aber wenn sie nicht als solche erklärt werden, wenn ein klärender und reflektierender Dialog ausbleibt, ist der Interpretationsspielraum für Patienten sehr groß. Und leider ist es naheliegend, dass solche Kommentare oder Fragen als persönliche Wertungen ankommen.
Ich weiß natürlich nicht, ob sich diese Situation zwischen ihr und Ihnen geklärt hat. Ich wünsche es Ihnen! Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie diese Erfahrung für sich im Nachhinein so einordnen können, dass es Sie nicht weiter belastet.
Ich wünsche Ihnen alles Gute,
Tatjana
Hallo …
Ich möchte mich auch sehr gern zu diesem Thema äußern
Ich habe eine 3Jährige tiefenpsychologische Psychotherapie hinter mir .
Am Ende der Therapie ging es mir nicht sehr viel besser .Als ich darüber mit meiner Therapeutin reden wollte blickte sie mich ab und meinte :
Ich hätte dann doch besser eine Verhaltenstherapie machen sollen
Diese Aussage von ihr hat mich sehr frustriert…
3 Jahre umsonst ?
Keine Information ihrerseits am Anfang der Therapie …
Ich hab die Therapie sehr frustriert und unglücklich verlassen
Heute befinde ich mich in einer Verhaltenstherapie und merke wie es langsam aufwärts geht
Liebe Sylvia,
vielen Dank, dass du dich getraut hast deine Erfahrung mit mir zu teilen. Leider hast du damit keine positive Erfahrung mit Psychotherapie gemacht und ich muss sagen, der Satz ist doch sehr unglücklich gewählt. 🙁 Ich könnte jetzt natürlich Mutmaßungen anstellen, warum diese Therapeutin das so gesagt hat. Aber Fakt ist, es hat dich verwirrt und frustriert. Natürlich stellt man dann in Frage, ob die ganzen letzten 3 Jahre „umsonst“ waren. Würde mir genauso gehen! Umso mehr freut es mich, dass du nun in einer VT-orientierten Therapie bist, die dir anscheinend auch was bringt. Weiter so und Kopf hoch! Egal, was noch kommt, heutzutage ist es sehr wichtig als PatientIn selbstwirksam zu bleiben, auch und vor allem in der Psychotherapie.
Alles Gute für dich!
Tatjana
Ich befinde mich gerade in einer tiefenpsychlogisch fundierten Psychtherapie (6. Stunde). Jetzt pausiert diese für 5 Wochen ( weg. Urlaub ). Ich habe mir selber eine Aufgabe für die Zeit der Therapiepause gestellt. Jedoch habe ich es bis jetzt nicht geschafft, diese umzusetzen. Jetzt sind es nur noch 3 Wochen und ich bin jetzt schon völlig fertig, wenn ich wieder zur Therapie gehe und ich nix „abliefern“ kann.
Bin richtig verzweifelt. 🙁
Derzeit bin ich Patient in einer psychiatrischen Tagesklinik mit Psychotherapie in der Gruppe und im Einzelgespräch. Ein Mitpatient wurde kürzlich vorzeitig entlassen, weil er sich nicht an eine „Regel“ gehalten hat. Aufgrund der Verletzung der „Regel“ wurde der Mitpatient von der Gruppentherapie und einem anderen Therapieangebot ausgeschlossen und es wurde von Seiten der Tagesklinik argumentiert, dass eine weitere Behandlung in der Tagesklinik keinen Sinn machen würde, da der Patient nicht an der Gruppentherapie und dem anderen Therapieangebot teilnehmen würde und deshalb eine Entlassung des Patienten notwendig sei. Der Patient ist dann auch tatsächlich entlassen worden. Die „Regel“, die der Patient nicht eingehalten hatte, bestand darin während der Therapie auf einem Stuhl zu sitzen. Eine andere Sitzgelegenheiten wurde als unzulässig erachtet. Der Patient hatte einen triftigen Grund nicht auf einem der Stühle sitzen zu wollen. Die im Therapieraum vorhandenen Stühle haben beim Sitzen Beschwerden verursacht, die ein Bürostuhl oder ein anderer ergonomischer / rückenfreundlicher Stuhl nicht oder in geringerem Umfang verursacht hätte. Meine Frage ist, ob der Therapieabbruch durch die Tagesklinik eine gerechtfertigte Maßnahme war oder nicht.
Hallo,
vielen Dank, dass du dich mit deiner Frage an mich wendest. Um ehrlich zu sein, wirft die beschriebene Situation bei mir viele Fragen auf und am liebsten würde ich mit den Verantwortlichen persönlich sprechen, um zu klären, weshalb dein Mitpatient auf diese Weise vorzeitig entlassen wurde. Wenn es tatsächlich so ist, wie du beschreibst, und es keine anderen unbekannten Gründe für die Entlassung gab, liegt die Antwort deiner Frage auf der Hand. Eine disziplinarische Entlassung muss klare Regelverletzungen als Ursache haben. Diese Regelverletzungen müssen entweder auf eine Verweigerung der Therapie, eine fehlende Bereitschaft zur Mitarbeit oder eine andauernde Störung des Therapieprozesses anderer Patienten haben. Ob das auf deinen Mitpatienten zutraf, ist unklar und mindestens fragwürdig. Wichtig ist nun, dass du dich davon nicht zu sehr runterziehen lässt und dich weiterhin auf deine Therapien konzentrierst. Kannst du noch etwas für dich mitnehmen? Kannst du noch weiterhin von den Therapien profitieren? Hast du noch Vertrauen in deine Gruppen- und Einzeltherapien? Das ist nun, worauf du dich konzentrieren darfst. Wenn dich die Situation mit deinem Mitpatienten dennoch und dauerhaft belastet, sprich es bitte in deiner Einzeltherapie an. Versuch eine Klärung zu finden und bilde dir am Ende immer eine eigene Meinung über das Geschehen.
Ich wünsche dir in deinem Prozess das Beste!
Liebe Grüße
Tatjana
Vielen Dank für die Antwort. Der Mitpatient war in der selben Gruppe wie ich weshalb wir von der Einzeltherapie abgesehen an allen Therapieangeboten gemeinsam teilgenommen haben. Der Mitpatient war angenehm, zurückhaltend und hat sich m.E. konstruktiv an der Therapie beteiligt. Wie die Einzeltherapie gelaufen ist, kann ich natürlich nicht wissen. Aus diesem Grund scheint mir die vorzeitige Entlassung nicht nachvollziehbar zu sein.
Die psychiatrische Tagesklinik in der ich zur Zeit Patient bin hat einen guten Ruf und ich habe bis zu dem Vorfall mit der vorzeitigen Entlassung des Mitpatienten einen guten Eindruck von der Tagesklinik gehabt. Die Therapie war bisher definitiv gut für mich und ich habe mich dank des Tagesklinikaufenthalts stabilisiert. Ich kann mir gut vorstellen weiterhin die Tagesklinik zu besuchen. Allerdings ist mein Vertrauen in die Tagesklinik geringer geworden, weil ich sensibel auf Vorfälle reagiere bei denen einiges auf Willkür, Machtmissbrauch und autoritäres Verhalten hindeutet. Ich habe in der Einzeltherapie das Thema angesprochen und gesagt, dass mich die Reaktion der Tagesklinik auf das Problem mit dem Stuhl irritiert. Außerdem habe ich in der Gruppentherapie gefragt warum es offensichtlich als indiskutabel angesehen wird dem Mitpatienten zu erlauben auf einer anderen Sitzgelegenheit zu sitzen. Die Antwort war meiner Meinung nach nicht stichhaltig.
Allerdings habe ich jetzt Bedenken, dass ich als Querulant angesehen werde, weil ich anders als die anderen Patienten meine Ansicht zu dem Vorfall geäußert habe. Die Mitpatienten, die ebenfalls live mitbekommen haben was vorgefallen ist, haben sich nicht dazu geäußert. Allerdings ist es ein Gesprächsthema unter den Patienten und die Meinung ist einhellig Unverständnis für die Reaktion der Tagesklinik.
Im Rahmen der Behandlung in einer psychiatrischen Klinik habe ich auch Psychotherapie. Während der Therapiesitzungen kam die Therapeutin immer mal wieder auf ein Thema zu sprechen über das ich offen sprechen kann, wenn ich den Eindruck habe nicht dazu genötigt zu werden. Das Thema ist für mich nicht angenehm, aber kein Problem, wenn ich das Gefühl habe nicht auf meine körperlichen Einschränkungen reduziert zu werden. Nun hat mich meine Therapeutin mehrfach mal mehr und mal weniger direkt darauf angesprochen, was mir unangenehm ist und wo ich den Sinn nicht sehe. Was möchte die Therapeutin mit damit bezwecken? Oder ist es einfach eine unangemessene Form der Neugier?
Hallo,
ich danke dir für deine Frage und möchte gerne darauf eingehen.
Fakt ist wir beide können nicht in den Kopf dieser Person reinschauen und wir kennen ihre Motive nicht. Solltest du erneut in eine ähnliche Situation in der Therapie geraten, rate ich dir, es ehrlich anzusprechen. Äußere dein Unwohlsein und deine Bedenken, sage ruhig auch, dass dich das nach den Sitzungen noch beschäftigt und du gerne klären möchtest, warum solche Thematiken auf eine bestimmte Art angesprochen werden. Ehrliche und direkte Kommunikation ist hier der beste Weg, um schnelle Lösungen zu finden. Und sollte der Fall auftreten, dass sich die Therapeutin oder der Therapeut in Ausreden flüchtet oder den Ball immer wieder zu dir zurück schießt, konfrontiere sie/ihn damit, dass das jetzt keine therapeutische Intervention ist, sondern wichtig für eine weitere vertrauensvolle Beziehung. Du brauchst ehrliche Antworten, etwas Glaubhaftes und Konkretes. Punkt. Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Alles Gute für dich,
Tatjana
Hallo,
mein Leben ist von sehr vielen traurigen Momenten geprägt. Mein Mann verstarb an Krebs als ich 24 Jahre alt war. Er war 27 Jahre. Wir waren schon vor der Erkrankung ein Paar!
Ich hab ihn damals gepflegt und begleitet. Ich ging in Therapie. Der einzige Ansatz damals war, dass ich mir das alles ausgesucht hätte und ich mein Leid so gewollt hätte. Nicht der Verlust meines Mannes und dessen Tod. Es war sehr erniedrigend und verletzend. 8 Jahre später erkrankte ich selbst an Krebs. Ich hatte mittlerweile ein Kind und einen neuen Lebenspartner. Therapie, Nächster Ansatz. Ich wollte krank sein bzw. werden. Bei meinem Kind wurde eine Verletzung übersehen, die das Kind zwar überlebt hat, aber lebenslange Folgeschäden verursacht hat. Die Begründung für den Diagnose Fehler war, die Meinung, mein Kind wollte Aufmerksamkeit! Weil ich ja krank war.
Rückblickend kann ich sagen, das schlimmste an unserer Geschichte war und ist, die Unterstellung und die Folgen, dass wir das alles gewollt hätten.
Tod, Krankheit, Leid.
Welche Gedankengänge hat ein Psychologe/in einer Patientin solche schwerwiegenden Unterstellungen zu unterbreiten?
„Selbst schuld zu sein“ Wieso bei Krankheit überhaupt „schuldig“ zu sein?
Hallo,
meine Tochter 15 ist zur Zeit in Therapeutischer Behandlung wegen Depressionen. Jetzt sollten die Therapie Ziele neu gestaltet werden und das fiel meiner Tochter sehr schwer. Sie hat die ganze Zeit geweint weil sie Angst vor der Zukunft hat und die ganzen Ziele sinnlos findet, weil es ja eh nichts bringt. Wie müsste sich die Therapeutin denn jetzt verhalten? Sie möchte nun nächste Wo ein Gespräch mit uns Eltern und unsere Tochter zusammen und besprechen wie es nun weitergehen kann. Für mich fühlt sich das an, als will sie aufgeben. So nach dem Motto, wenn ihr Kind so hoffnungslos ist, dass es keine Ziele ankreuzen kann…..macht das keinen Sinn.
Lg Anne